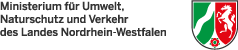Aus der Flächenpraxis
 © Mario Hagen / Pixabay
© Mario Hagen / Pixabay Aus der
Flächenpraxis
Engagement für mehr Flächenschutz – schafft vielfältige Lösungen
Aus der Flächenpraxis
Der Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin ein zentrales Umweltproblem mit vielfältigen Ursachen und Folgewirkungen. Fortschritte zu seiner Reduzierung sind im Jahr 2022 mit 5,6 Hektar neuer Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag zwar erkennbar, aber für einen Beitrag zum Bundesziel bis zu einem Netto-Null-Verbrauch ist es noch ein langer Weg.
Die Akteure im Land sind künftig weiter gefordert, erfolgversprechende Strategien und Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die dem komplexen Problem der Flächenneuinanspruchnahme wirksam begegnen. Daher ist es das Anliegen der Allianz für die Fläche, das Bewusstsein für das Problem des wachsenden Flächendrucks für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu schärfen und für die vielfältigen Instrumente, Initiativen und Fortbildungsangebote (Verlinkung zu Aktuelles) einer nachhaltigen Flächenentwicklung zu werben und zur Nachahmung aufzurufen. Denn eine nachhaltige Flächenentwicklung hat für die Kommunen, aber auch für die Bevölkerung, entscheidende Vorteile:
- Schutz von Natur und Landschaft
- Schutz vor Folgen des Klimawandels
- Stärkung gewachsener Zentren
- Erhöhung der Lebensqualität für die Bevölkerung
- effiziente Ausnutzung bestehender Infrastrukturen
- Kosteneinsparung für Infrastrukturen
- Vermeidung von Verkehrsbelastung
- Werterhalt von Immobilien
Instrumente zum Flächensparen
Zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke und für eine nachhaltige Stadt- und Flächenentwicklung sind in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Instrumente und Verfahren konzipiert und in Modellvorhaben in der Praxis erprobt worden.
Flächeninformationen
Für eine nachhaltige Stadt- und Flächenentwicklung sind Informationen zum Vorhandensein und zur räumlichen Verortung von potentiellen Flächenreserven in Städten und Kommunen essenziell. Flächen mit Entwicklungspotenzialen können in einem Katasterinformationssystem (z.B. Brachflächen- oder Baulückenkataster) erfasst, bewertet, visualisiert und analysiert werden.
Mit diesen Informationen können innerstädtische Flächen besser in der Planung berücksichtigt werden und tragen somit zum Grundsatz der „Innen- vor Außenentwicklung“ bei.
Die landesweite Erfassung von Brachflächen erfolgt durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Dabei werden über eine Luftbildauswertung potentielle Brachflächen im Siedlungsbereich erfasst und zusätzliche Informa-tionen zu den Flächen bereitgestellt. Die Daten werden den jeweiligen Kommunen und den Bezirksregierungen in NRW zur Verfügung gestellt. Die Kommunen können die Daten weiter qualifizieren und in ein eigenes Brachflächenkataster überführen.
Im Rahmen des Siedlungsflächenmonitoring werden in NRW Flächenreserven (Flächen bei denen zum Stand der Erhebung keine Baumaßnahme erfolgt oder dauerhaft ungenutzt sind) erfasst.
Weiterführende Informationen:
Flächenrecycling
Für eine nachhaltige Flächenentwicklung muss die Erhaltung der Ressource Boden stärkere Berücksichtigung finden. Neben der generellen Reduzierung der Flächeninanspruchnahme gehören dazu auch qualitative Aspekte wie die Wiedernutzung von Brachflächen, Reaktivierung von integrierten Flächenpotenzialen und die Schonung besonders wertvoller und schutzwürdiger Böden. Auch die stärkere Nutzung von Entsiegelungspotenzialen und die entsprechende Berücksichtigung in der Eingriffsregelung gehören dazu.
Einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Neuinanspruchnahme von Freiflächen leistet die Reaktivierung von Industrie-, Verkehrs- und Militärbrachen - das sogenannte "Flächenrecycling". Dies aber nur, wenn die aufbereiteten Flächen vermark-tet und die angestrebten Nutzungen realisiert werden können. Viele durch den wirtschaftlichen Strukturwandel brach gefallene Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen können gleichwohl in einzelwirtschaftlicher Betrachtung nicht rentierlich aufbereitet werden.
Um für die Flächenreaktivierung weiterhin öffentliche Mittel einsetzen zu können, wird beständig darauf hingewirkt, dass die Altlastensanierung als Förderzweck in möglichst vielen flächenbezogenen Förderprogrammen verankert bleibt oder wird. Beispiele sind die regionale Wirtschaftsförderung, die Städtebauförderung und die EU-Strukturprogramme. Eine beispielhafte Kooperation von Land, Wirtschaft und Kommunen stellt in Nordrhein-Westfalen der AAV - Verband für Flächenrecycling und Alt-lastensanierung dar.
Weiterführende Informationen:
AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung
Innentwicklung / Nachverdichtung
Zur Umsetzung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung ist die Innenentwicklung ein bedeutender Baustein. Wesentliche Handlungsmaxime einer nachhaltigen Flächenentwicklung ist zusätzlich zum Reduktionsziel der Flächenneuinanspruchnahme das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“.
Neben der Aktivierung von großen integrierten Flächenpotenzialen wie z. B. Industrie- oder Militärbrachen fällt in den Städten und Gemeinden der Nutzung von kleineren Nachverdichtungspotenzialen im Siedlungsbestand daher eine bedeutende Rolle zu, um die weitere Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in den Außenbereich einzudämmen. Die Potenziale für eine Nachverdichtung liegen vor allem in der Aktivierung von Baulücken, Brachflächen, leerstehenden Gebäuden, mindergenutzten Grundstücken und der Aufstockung von Gebäuden sowie der multicodierten Nutzung von Flächen und Gebäuden. Eine Nutzung solcher Innenentwicklungs- und Nachverdichtungspotenziale im Siedlungsbestand hat für die Kommune, neben dem Verzicht auf Inanspruchnahme von unversiegelten Flächen im Außenbereich, entscheidende Vorteile:
- Stärkung der Innenstadt
- Stadt der kurzen Wege
- Innerörtliche Belebung und Aufwertung
- Verjüngung überalterter Strukturen
- Bessere Auslastung vorhandener Infrastrukturen
- Einsparen der Unterhaltungskosten für zusätzliche Infrastrukturen im Außenbereich
- Durchmischung der Quartiere