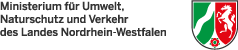Belastungen durch Mikroschadstoffe, Antibiotika und vieles mehr
Belastungen durch Mikroschadstoffe, Antibiotika und vieles mehr
Auch jenseits von Phosphor und Nitrat sind viele Gewässer mit Schad- und Nährstoffen aus Industrie, Landwirtschaft, Haushalten und Infrastruktur belastet. Für einige dieser Stoffe hat die EU verbindliche Grenzwerte festgesetzt. Darunter sind gefährliche Stoffe wie PCB und Quecksilber, die in der Umwelt nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden.
 © HansPeter Schröer / Pixabay
© HansPeter Schröer / Pixabay Bundesweit sind für weitere Stoffe wie Kupfer, Zink, Pflanzenschutzmittel und Industriechemikalien Grenzwerte festgelegt worden. Sie decken aber nur einen Bruchteil der in die Gewässer gelangenden Substanzen ab.
Arzneimittel, Kosmetikprodukte, Pflanzenschutzmittel, Biozide und Industriechemikalien sind aus unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Gelangen diese über punktuelle oder diffuse Eintragspfade in die Gewässer, können sie sich bereits in niedrigen Konzentrationen negativ auf aquatische Ökosysteme auswirken. Der Eintrag von diesen sogenannten Mikroschadstoffen stellt für das bevölkerungsreiche Industrieland Nordrhein-Westfalen mit seinem hohem Abwasseranteil in den Gewässern eine Herausforderung dar. Nordrhein-Westfalen verfolgt zur Reduzierung des Mikroschadstoffeintrags in die Gewässer seit langem umfassende Maßnahmenansätze – von den Eintragsquellen bis hin zu nachgeschalteten Maßnahmen an Kläranlagen. Kommunale Kläranlagen stellen einen relevanten Eintragspfad für den Eintrag Mikroschadstoffen in die aquatische Umwelt dar. Insbesondere der Einsatz von Arzneimitteln wird aufgrund der weit verbreiteten Anwendung in privaten Haushalten nicht generell an der Eintragsquelle zu verhindern sein, sodass am Ende der Kette auch Abwasserbehandlungsmaßnahmen erforderlich sind.
One-Health und Antibiotikaresistenzen
In der Antike erkannte Hippokrates, dass die menschliche Gesundheit von einer sauberen Umwelt abhängt. Mitte des 19. Jahrhunderts prägte Virchow den Begriff Zoonosen für Krankheiten, die von Tieren auf Menschen oder umgekehrt übertragen werden können. Im Jahr 1928 war die eher zufällige Entdeckung der Antibiotika ein weiterer Meilenstein der Medizingeschichte. Bakteriell verursachte Infektionen und Entzündungen konnten damit wirksam behandelt werden. Heutzutage nimmt die Zahl der gegen Antibiotika resistenten Bakterien zu. Da Antibiotika sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin zum Einsatz kommen, können resistente Bakterien durch Kontakt zwischen Mensch und Tier oder über den Konsum von Lebensmitteln, die Träger von antibiotikaresistenten Bakterien sein können, übertragen werden. Durch den Eintrag von Antibiotikarückständen und antibiotikaresistenten Bakterien aus Kläranlagen sowie durch Einträge aus der Landwirtschaft (zum Beispiel Gülle) in die Umwelt werden die Selektion von antibiotikaresistenten Bakterien und die Weitergabe von Antibiotikaresistenzgenen begünstigt. Die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ist eng miteinander verknüpft. Ein vorsorgendes, sektor- und medienübergreifendes Handeln ist notwendig, für den der „One-Health-Ansatz“ steht. Unter der Überschrift „One Health“ Antibiotikaresistenz im Spannungsfeld von Mensch, Tier und Umwelt ist es auch ein Thema des Masterplans Umwelt und Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus sind die Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie für Landwirtschaft und Verbraucherschutz rund um die Thematik „Antimikrobielle Resistenzen“ in einem engen Austausch.
Neben Mikroschadstoffen und Mikroplastik haben Antibiotika eine besondere Brisanz für die Wasserwirtschaft. Antibiotika spielen in der Medizin bei der Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten eine außerordentlich wichtige Rolle. Indes gibt es vermehrt Nachweise für das Vorkommen antibiotikaresistenter Bakterien in Abwässern von Krankenhäusern, Kläranlagen und Schlachthöfen, in Oberflächengewässern sowie Böden. Da Antibiotika sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin zum Einsatz kommen, können resistente Bakterien durch Kontakt zwischen Mensch und Tier oder über den Konsum von Lebensmitteln, die Träger von antibiotikaresistenten Bakterien sein können, übertragen werden. Durch den Eintrag von Antibiotikarückständen und antibiotikaresistenten Bakterien aus Kläranlagen sowie durch Einträge aus der Landwirtschaft (zum Beispiel Gülle) in die Umwelt werden die Selektion von antibiotikaresistenten Bakterien und die Weitergabe von Antibiotikaresistenzgenen begünstigt. Die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ist eng miteinander verknüpft. Ein vorsorgendes, sektor- und medienübergreifendes Handeln ist notwendig, für das der „One Health Ansatz“ steht.
Unter der Überschrift „One Health – Antibiotikaresistenz im Spannungsfeld von Mensch, Tier und Umwelt“ ist es auch ein Thema des Masterplans Umwelt und Gesundheit Nord- rhein-Westfalen. Darüber hinaus sind die Ministerien für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie für Landwirtschaft und Verbraucherschutz rund um die Thematik „Antimikrobielle Resistenzen“ in einem engen Austausch. Nordrhein-Westfalen möchte die Entstehung und Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakterien in der Umwelt besser verstehen und hat dazu Untersuchungen in Oberflächengewässern und Abwassereinleitungen durchgeführt.
PFAS führen als „Ewigkeitschemikalien“ zu einer irreversiblem Umweltexposition und -akkumulation und machen nicht nur in Böden, sondern auch in Gewässern ernste Probleme. In Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2006 die illegale Aufbringung PFAS-haltiger Bioabfälle auf Ackerflächen im Hochsauerland als wesentlicher Eintragspfad für außergewöhnlich hohe Belastungen in der Ruhr identifiziert. Seitdem wurden viele Ursachen für PFAS-Belastungen in Gewässern festgestellt: Einträge über den Luftpfad (insbesondere Abluft von Industriebetrieben), punktuelle Einträge aufgrund von Altlasten und Schadenfällen (vor allem Feuerlöschschäume) sowie Abwassereinleitungen (insbesondere aus Produktionsprozessen der Chemiebranche, von Galvanik- und Druckbetrieben Papier- und Lederfabriken, Textilveredlern und aus gewissen Deponien). Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, für Abwasser Regelungen zu PFAS-Verbindungen rechtsverbindlich auf den Weg zu bringen. Da eine entsprechende Regelung auf Bundesebene bis dato nicht erfolgte, wurden 2006 sogenannte Vorsorgewerte eingeführt und seitdem stetig weiterentwickelt. Bei Überschreitung solcher Werte erfolgt eine Ursachenanalyse und die Einleitung von Gegenmaßnahmen. Dadurch soll vor allem das Vordringen von PFAS in das Rohwasser der Trinkwassergewinnungen weitgehend unterbunden werden. Für das Trinkwasser wurden mit der neuen Trinkwasserverordnung 2023 erstmals Grenzwerte für PFAS festgelegt. Im Oberflächengewässermonitoring existieren derzeit Umweltqualitätsnormen für Perfluoroctansulfonsäure (eine chemische Verbindung aus der Gruppe der PFAS) im Wasser und in Fischen.
Land fördert Ausbau der 4. Reinigungsstufe
Der Schutz der Gewässer ist Daseinsvorsorge und von oberster Priorität für die Landesregierung. Die
Abwasserbeseitigung wird dabei heute mit verschiedenen Anforderungen konfrontiert. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und die Gewässer noch besser zu schützen, werden Maßnahmen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung durch die Landesregierung unterstützt. Dies gilt auch für den Ausbau von Kläranlagen mit der sogenannten 4. Reinigungsstufe.
Die vierte Reinigungsstufe stellt keine einzelne bestimmte Klärtechnik dar, sondern umfasst verschiedene Verfahrenstechniken wie zum Beispiel die Ozonung, die Behandlung mit Aktivkohle sowie die Kombination einzelner Verfahrensstufen. Ziel dieser zusätzlichen Stufe ist es, den Eintrag von Mikroschadstoffe wie Medikamentenresten, Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln, Korrosionsschutzmitteln oder synthetischen Duftstoffen aus Körperpflegeprodukten in die Gewässer zu reduzieren. Diese Substanzen können von herkömmlichen Kläranlagen ohne 4. Reinigungsstufe nicht oder nur zum Teil entfernt werden und gelangen daher so in die Gewässer.
Von den in Nordrhein-Westfalen betriebenen 589 kommunalen Kläranlagen sind zum Stand 31.12.2024 inzwischen 25 Kläranlagen mit einer 4. Reinigungsstufe zur Reduzierung des Eintrags von Mikroschadstoffen ausgebaut und in Betrieb. Weitere 11 Anlagen sind im Bau, 16 Anlagen sind in Planung.
Die bisher umgesetzten und geplanten Maßnahmen auf Kläranlagen zum Ausbau mit einer 4. Reinigungsstufe wurden in der Regel mit Landesmitteln gefördert; seit Ende 2023 über das Förderprogramm „Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen“ (ZunA NRW). Neben dem Ausbau von Kläranlagen zur Mikroschadstoffreduzierung unterstützt NRW auch die Forschung und Weiterentwicklung von Technologien zur Mikroschad-stoffreduzierung.
Als großes Förderungsprojekt wurde Anfang April 2025 in Dortmund-Deusen die erste 4. Reinigungsstufe an der Emscher offiziell in Betrieb genommen. Die Pulveraktivkohledosierung mit nachgeschalteter Tuchfiltration ist derzeit die weltweit größte ihrer Art und mit einer Ausbaugröße von rund 700.000 Einwohnerwerten die größte 4. Reinigungsstufe in NRW (der Einwohnerwert für Kläranlagen umfasst Einträge aus Privathaushalten sowie Industrie und Gewerbe). Sie ist mit mehr als 30 Millionen Euro Landesmitteln gefördert worden.