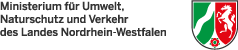Klimaangepasste Wiederbewaldung und Waldentwicklung
Klimaangepasste Wiederbewaldung und Waldentwicklung
Laut Bundeswaldinventur 2022 ist die häufigste Baumart in Nordrhein-Westfalen die Buche mit 21 %, gefolgt von der Fichte mit 20 %, der Eiche mit 19 % sowie der Kiefer mit 8 %. Bedeutend sind auch die Birke mit 7 %, die Lärche mit 4 %, die Douglasie mit 2 % und die Tanne mit 1 %.
 © Hans Linde / Pixabay
© Hans Linde / Pixabay Der Laubbaumanteil an der bestockten Waldfläche stieg im Verlauf von 35 Jahren von 48 % auf 66 % beziehungsweise etwa 530.000 Hektar. Der Nadel- baumanteil sank stattdessen von 52 % auf 34 % (etwa 280.000 Hektar).Unbestockte Lücken und Blößen machen 9 % oder etwa 80.000 Hektar der Waldfläche aus.
Nach der 2024 erstmalig durchgeführten Stichprobenerhebung zur Wiederbewaldung auf den Fichten-Schadflächen sind etwa 46 % wiederbewaldet, davon etwa 64 % durch Naturverjüngung und 36 % durch Pflanzung. Laubholz-Baumarten machen 46 % und Nadelholz-Arten 54 % aus. Häufigste Baumarten sind die Fichte (33 % ), Weichlaubhölzer (32 %) und die Douglasie (13 %).
Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels empfehlen die Klimaanpassungsstrategie für den Wald, das Waldbaukonzept und das überarbeitete Wiederbewaldungskonzept für eine Walderneuerung auf Kalamitätsflächen standortgerechte Mischbestände. Mischwälder sind gegenüber Reinbeständen ökologisch stabiler, artenreicher und forstwirtschaftlich weniger risikoreich. Das Waldbaukonzept beinhaltet 23 Waldentwicklungstypen. Davon sind 14 Typen von Laubbäumen geprägt und 9 von Nadelbäumen. Es handelt sich um Varianten von idealtypischen standortgerechten Buchenmischwäldern, Eichenmischwäldern und weiteren Laubmischwäldern sowie Nadelmischwäldern. Der Schwerpunkt liegt auf hierzulande etablierte Baumarten. Empfohlen werden aber auch Waldentwicklungstypen mit Mischungsanteilen etablierter eingeführter Baumarten aus anderen biogeografischen Regionen (Douglasie und Roteiche) sowie ausgewählte eingeführte Baumarten für ein experimentelles Einbringen außerhalb von Schutzgebieten. Im Rahmen des Wiederbewaldungskonzepts wird die sinnvolle Kombination von geeigneter Naturverjüngung und ergänzender Pflanzung empfohlen. Dies beinhaltet drei verschiedene Pflanzintensitäten: reguläre Pflanzung mit 70 Prozent Flächenanteil, extensive Pflanzung mit 30 Prozent Flächenanteil und Ini-tialpflanzung mit mindestens 400 Bäumen in den beiden Varianten Trupp-Pflanzung und Vorwald. Digitale Karten zu Wäldern und für die Waldbewirtschaftung für alle Akteure mit Waldbezug und die breite Öffentlichkeit sowie weitere Informationen finden sich unter www.waldinfo.nrw.de.
Hans Carl von Carlowitz und das Prinzip der Nachhaltigkeit
Von Carlowitz (1645 bis 1714) war Oberberghauptmann für das Erzgebirge am kursächsischen Oberbergamt in Freiberg. Er gilt als Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit. Zu seiner Zeit war der Silberbergbau im Erzgebirge, das wirtschaftliche Rückgrat Sachsens, durch eine akute Holzknappheit in seiner Existenz bedroht. Holz war damals der wichtigste Rohstoff und Energieträger. Unter anderem wurde es dringend als Grubenholz für die Bergwerke und den Betrieb der Schmelzöfen mit Holzkohle benötigt. Die Bergbauregionen waren jedoch kahlgeschlagen, es wurde Raubbau betrieben. Von Carlowitz folgerte daraus in seinem forstwissenschaftlichen Werk „Sylvicultura oeconomica“ im Jahr 1713 erstmals, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch gezielte Aufforstung, durch Säen und Pflanzen nachwachsen könne.

Umweltindikator Laub- und Nadelbaumanteil
Nach den Bundes- und Landeswaldinventuren sowie der Kohlenstoffinventur im Jahr 2017 hat sich der Laubbaumanteil in Nordrhein-Westfalen in den letzten 35 Jahren von 48 auf 66 % erhöht, der Nadelbaumanteil ist entsprechend von 52 auf 34 % gesunken. Diese Entwicklung ist nicht nur auf erhebliche Sturm- und Dürreereignisse zurückzuführen, sondern auch dem aktiven Waldumbau hin zu strukturreichen Mischbeständen zu verdanken. Eine Trendberechnung wurde aufgrund der großen zeitlichen Abstände zwischen den Erhebungen nicht durchgeführt. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, im Rahmen von waldbaulichen Maßnahmen standortgerechte Mischbestände aus überwiegend heimischen Baumarten weiter auszubauen.
Weitere Informationen:
- 4. Bundeswaldinventur
- Broschüre: Wald und Waldmanagement im Klimawandel
- Waldbaukonzept Nordrhein-Westfalen (MLV)
- Wiederbewaldungskonzept Nordrhein-Westfalen (MLV)
- Waldinfo.NRW (MLV)
- Informationsportal der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur nachhaltigen Entwicklung in NRW
- Umweltindikator Laub- und Nadelbaumanteil (LANUK)