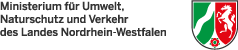Der Zustand unserer Fließgewässer und des Grundwassers
Der Zustand unserer Fließgewässer und des Grundwassers
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“, so die EU-Wasserrahmenrichtlinie.
 © Nina Rodewyk
© Nina Rodewyk Die EU setzt darin den Mitgliedsstaaten das Ziel, den „guten oder sehr guten Zustand“ für alle natürlichen Gewässer sowie das „gute oder sehr gute Potenzial“ für alle erheblich veränderten und künstlichen Gewässer“ bis spätestens zum Jahr 2027 zu erreichen.
Das ist keine leichte Aufgabe für Nordrhein-Westfalen bei einer Bevölkerungsdichte von 532 Einwohnern pro Quadratkilometer, rund 10.400 Industriebetrieben und knapp 34.000 landwirtschaftlichen Betrieben. Rund 1,9 % der Landesfläche sind Gewässer, davon etwa 1,0 % Fließgewässerwässer. Die meisten Flüsse sind reguliert, viele Gewässer wie Kanäle, Talsperren oder die Restseen ehemaliger Tagebaue sind künstlichen Ursprungs. Die Sümpfungsmaßnahmen des Kohleabbaus wirken sich weitreichend und langanhaltend auf das Grund- und Oberflächenwasser aus. Außerdem leiten in Nordrhein-Westfalen 594 kommunale Kläranlagen rund 2,1 Milliarden Kubikmeter und 393 Industriebetriebe etwa 680 Millionen Kubikmeter behandeltes Abwasser im Jahr direkt in die Oberflächengewässer ein (ohne Kühl- und Niederschlagswasser).
 © MUNV NRW
© MUNV NRW Grad der Veränderung der Gewässerstruktur oberirdischer Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen
Die Bewertung der Gewässerstruktur für Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet von mehr als 10 Quadratkilometern, wird anhand von rund 30 bundesweit abgestimmten Parametern vorgenommen (zum Beispiel Laufkrümmung, Tiefenvarianz, Sohlsubstrat, Uferbewuchs, Flächennutzung). Zur Jahrtausendwende hatten nur 15 % der Fließgewässer eine unveränderte, gering oder mäßig veränderte Gewässerstruktur (Strukturklassen 1, 2 oder 3). Erste lokale Verbesserungen durch zahlreiche erfolgreich durchgeführte Renaturierungsmaßnahmen zeigen sich mit einer Steigerung auf rund 18,6 %.
Naturnahe Fließgewässer laufen mehr oder weniger mäandrierend, bilden Inseln aus und verzweigen sich. Durch ihre variable Strömung und Tiefe beherbergen die Gewässerbetten in Kies, Sand, Wurzelwerk und zerfallenden Blättern eine große Artenvielfalt: In einem Kubikmeter Wasser können bis zu 120.000 Organismen leben. Ein Großteil unserer Fließgewässer hat jedoch über die Jahrhunderte seine ursprüngliche Lebensraumfunktion und viele der Ökosystemleistungen verloren: Durch Aufstauen zur Nutzung der Wasserkraft für den frühen Erzbergbau und die heutige Elektrizitätswirtschaft, durch die Entwässerung der Niederungen und Auen für die Landwirtschaft, durch Begradigungen, Talsperren, den Ausbau für die Binnenschifffahrt und starkes Schiffsverkehrsaufkommen. Auch die Folgen des Steinkohlebergbaus und des Braunkohletagebaus wirken sich als Ewigkeitslasten auf die Oberflächengewässer und das Grundwasser aus. Damit ein guter ökologischer Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial erreicht werden kann, muss den Gewässern ein Teil ihrer ursprünglichen Gewässerstruktur und Dynamik zurückgegeben werden. Mit dem Programm „Lebendige Gewässer“ unterstützt das Land Maßnahmen zur ökologischen Gewässerentwicklung und fördert sie mit bis zu 80 % der Kosten. Diese Maßnahmen mindern die Folgen von Gewässernutzungen, verbessern die Lebensräume für Tiere und Pflanzen und machen diese weniger anfällig für Belastungen wie die des Klimawandels. In den letzten Jahren wurden Hunderte von Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt. Eine landesweite Kartierung bildet die Veränderungen an den Fließgewässern ab.
Ewigkeitslasten und Monitoring für den Grubenwasseranstieg
Im Jahr 2018 endeten mit der Schließung der Zeche Prosper Haniel in Bottrop viele Jahrhunderte deutscher Bergbaugeschichte. Doch die Ewigkeitslasten mit Milliarden Euro Folgekosten für die Grubenwasserhaltung, Poldermaßnahmen und die Grundwasserreinigung bleiben dauerhaft. Dazu gehört zum Beispiel das Pumpen von Grubenwasser (Sümpfung), das zum Schutz der Grundwasservorräte und zur Stabilisierung des Untergrunds auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss. Dabei bereiten unter anderem Schwermetall- und Salzfrachten, die meist auf natürliche chemische, physikalische und biologische Prozesse im Untergrund zurückzuführen sind, und untertägig genutzte PCB-haltige Betriebsstoffe Probleme. Mit der Einstellung des Steinkohlenbergbaus gehen Veränderungen bei der Grubenwasserhaltung einher, die zur Trockenhaltung der Bergwerke eingerichtet wurde. Im Sinne eines Frühwarnsystems wird ein Integrales Monitoring für den Grubenwasseranstieg im Steinkohlenbergbau aufgebaut, um ungewollte Entwicklungen zu erkennen und mögliche Risiken für Schutzgüter minimieren zu können.
Rund 45 % aller Bäche und Flüsse des Landes mit einem Einzugsgebiet größer als 10 Quadratkilometer sind „natürliche Fließgewässer“. Die restlichen 55 % sind „erheblich veränderte und künstliche Fließgewässer“. Wie es um deren aquatische Lebensgemeinschaften steht, zeigt der Umweltindikator „Ökologischer Zustand/ökologisches Potenzial oberirdischer Fließgewässer“. Er wird anhand von Algenarten, Wasserpflanzen, wirbellosen Tieren wie Krebsen und Insektenlarven sowie Fischarten erhoben. Derzeit sind nur gut 18 % der natürlichen Fließgewässer (beziehungsweise 8,3 % aller Fließgewässer) des Landes in einem „sehr guten oder guten Zustand“. Von den durch Bauwerke wie Wehre, Dämme, Steinschüttungen sowie Begradigungen „erheblich veränderten und künstlichen Fließgewässern“ verfügen lediglich 2 % über ein „gutes oder sehr gutes Potenzial“ (1,1 % aller Fließgewässer). Das schlägt auch auf die Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen durch: 43,5 % der untersuchten Fische und Rundmäuler gelten als ausgestorben oder gefährdet. Zum Beispiel ist der einst häufige Stör ausgestorben, das Meerneunauge vom Aussterben bedroht sowie der ehemals in Massen vorkommende Lachs trotz Besatzmaßnahmen stark gefährdet. Selbst Allerweltarten wie der Hecht sind merklich zurückgegangen und stehen auf der Vorwarnliste (aktuell aber noch nicht gefährdet).
 © MUNV NRW
© MUNV NRW Umweltindikator Ökologischer Zustand/ökologisches Potenzial oberirdischer Fließgewässer
Rund 45 % aller Bäche und Flüsse des Landes, deren Einzugsgebiet größer als 10 Quadratkilometer ist, sind „natürliche Fließgewässer“, für die der „ökologische Zustand“ erhoben wird. 55 % sind „erheblich veränderte und künstliche Fließgewässer“, für die das „ökologische Potenzial“ bestimmt wird. Im Untersuchungszeitraum 2018 bis 2021 waren nur 8,3 % aller Fließgewässer in einem sehr guten oder guten ökologischen Zustand. Weitere 1,1 % verzeichneten ein sehr gutes oder gutes Potenzial. Das grundsätzliche Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist es, bis zum Jahr 2027 für alle oberirdischen Fließgewässer einen guten ökologischen Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial zu erreichen.
Erfolgreicher Umbau der Emscher
Die Emscher, einst als „dreckigster Fluss Deutschlands“ bekannt, hat dank eines der größten Infrastrukturprojekte Europas eine beeindruckende Transformation durchlaufen. Über Jahrzehnte hinweg diente sie als offener Abwasserkanal im Ruhrgebiet, doch mit dem Emscher-Umbau wurde sie in ein lebendiges Gewässersystem verwandelt.
Seit 1992 wurden 328 Kilometer der Emscher und hrer Nebenflüsse ökologisch aufgewertet. Ein zentrales Element dieses Umbaus war der Bau des 51 Kilometer langen Abwasserkanals Emscher, der das Abwasser unterirdisch ableitet und somit die Emscher von Verschmutzungen befreit. Dieser Kanal verläuft bis zu 40 Meter tief entlang des Flusses und sorgt dafür, dass die Emscher seit Ende 2021 schmutzwasserfrei ist.
Die ökologischen Vorteile dieses Umbaus sind vielfältig: Durch die Renaturierung entstanden neue Auenlandschaften und natürliche Flussläufe, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten. Und mit der Verbesserung der Wasserqualität kehren viele zuvor verschwundene Arten zurück, was zu einem Anstieg der Artenvielfalt führt. Aber nicht nur Pflanzen und Tiere profitierten vom milliardenteuren Umbau: Durch die ökologische Aufwertung des Flusssystems bietet die Emscher den Menschen in der Region neue Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten.
Die Landesregierung hat das Großprojekt durch die Bereitstellung finanzieller Mittel und eine enge Zusammenarbeit mit der Emschergenossenschaft sowie den Kommunen maßgeblich unterstützt.
Der Emscher-Umbau dient heute als leuchtendes Beispiel dafür, wie durch langfristige Planung und Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürgern eine nachhaltige Transformation erreicht werden kann. Die Emscher ist heute nicht nur ein Symbol für erfolgreichen Umweltschutz, sondern auch für den Strukturwandel im Ruhrgebiet hin zu einer lebenswerten und zukunftsfähigen Region.
Das Grundwasser ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Anforderungen der Grundwasserverordnung eingehalten werden. Ein „guter mengenmäßiger Zustand“ ist dann gegeben, wenn nicht mehr Wasser entnommen wird, etwa zur Trinkwassergewinnung oder zur Bewässerung, als auf natürlichem Wege neu gebildet wird. Die 3. Bestandsaufnahme zum chemischen und mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper Nordrhein-Westfalens fand auf Basis der von 2013 bis 2018 beobachteten rund 1.500 Wasserrahmenrichtlinien-Messstellen statt. 180 der insgesamt 275 Grundwasserkörper sind in einem guten chemischen Zustand (60 % der Landesfläche). 95 Grundwasserkörper sind in einem schlechten chemischen Zustand wegen Schwellenwertüberschreitungen durch Phosphor, Nitrat, Ammonium sowie Pflanzenschutzmittel aus diffusen Eintragsquellen. Punktuell ursächlich waren zudem Schwermetallbelastungen, leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, per- und polyfluorierte Aklylsubstanzen (PFAS), Bergbaufolgen, Altlasten und Grundwasserschadensfälle. Vor allem die durch Nitrat bedingte Anzahl der Grundwasserkörper in schlechtem Zustand ist mit 59 (26 % der Landesfläche) gegenüber 88 (42 % der Landesfläche) bei der 2. Bestandsaufnahme 6 Jahre zuvor niedriger ausgefallen. Gründe dürften unter anderem die Düngerechtsnovellen mit weiteren Einschränkungen für die Landwirtschaft in nitratbelasteten Gebieten, eine effizientere Düngung und eventuell Trockenheit in den Trockenjahren 2018 und 2019 mit geringeren Auswaschungen sein. Es befinden sich zudem 244 Grundwasserkörper des Landes in einem guten mengenmäßigen Zustand (87 % der Landesfläche). Die 31 Grundwasserkörper in schlechtem mengenmäßigem Zustand befinden sich in den Flussgebieten des Rheins und der Maas. Primär verantwortlich sind eine unausgeglichene Wasserbilanz durch Grundwasserspiegelabsenkungen beziehungsweise Sümpfungsmaßnahmen im rheinischen Braunkohlerevier.
Weitere Informationen:
- Programm "Lebendige Gewässer"
- Integrales Monitoring für den Grubenwasseranstieg im Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen
- Gewässerstruktur der Fließgewässer in NRW
- Grundwasserqualität
- Grundwasserbeschaffenheit (LANUK)
- Emscherumbau
- Umweltindikator Ökologischer Zustand/ökologisches Potenzial oberirdischer Fließgewässer (LANUK)