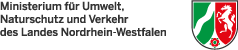Wasser und Planetare Grenze Veränderung in Süßwassersystemen
Wasser und Planetare Grenze Veränderung in Süßwassersystemen
Wasser ist nichts geringeres als die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Rund zwei Drittel des blauen Planeten sind von Wasser bedeckt. Etwa 97 % des weltweiten Wasservorkommens besteht aus salzhaltigem Meerwasser. Die restlichen rund 3 % sind Süßwasser, die zu gut zwei Dritteln im Eis der Polkappen und Gletscher und zu knapp einem Drittel als Grundwasser unter der Erdoberfläche gebunden sind. Das Oberflächenwasser der Flüsse, Sümpfe und Seen macht nur etwa 0,01 % des Gesamtwasservolumens aus.
 © Dr. Günter Bockwinkel NZO GmbH
© Dr. Günter Bockwinkel NZO GmbH Das Konzept der Planetaren Grenzen, das diesen Bericht wie ein roter Faden durchzieht, berücksichtigt unter anderem die menschengemachte Veränderung in Süßwassersystemen gegenüber der vorindustriellen Zeit. Unterschieden wird dabei zwischen „Blauem“ und „Grünem“ Wasser. Unter Blauem Wasser versteht man das Oberflächenwasser in Fließgewässern oder Seen sowie das Grundwasser in den Gesteinskörpern. Unter Grünem Wasser versteht man das im Boden oberhalb des Grundwassers befindliche Wasser (Bodenwasser), aber auch das Wasser, das über die Vegetation verdunstet und in Form von Wolken kondensiert. Grünes Wasser ist von großer Bedeutung für die Widerstandsfähigkeit der Biosphäre und für die Sicherung von Kohlenstoffsenken wie Wälder und Moore. Auch spielt es eine Rolle bei der Regulierung der atmosphärischen Zirkulation (die Wetterdynamik bestimmende Luftbewegungen). Anhand sogenannter Proxydaten zu Gewässerabflussmengen sowie zur Bodenfeuchte kam ein internationales Wissenschaftsteam zu dem Schluss, dass die Planetare Grenzen für Veränderungen in Süßwassersystemen beim Blauen Wasser um etwa das 0,8-fache und beim Grünen Wasser um etwa das 0,4-fache überschritten sind. Der Mensch hat mittlerweile so gravierend in die Süßwassersysteme eingegriffen, dass der „sichere Handlungsraum“ verlassen wurde. Wir befinden uns im Bereich „zunehmenden Risikos“, nicht zuletzt in Verbindung mit dem Klimawandel, weil aquatische Ökosysteme minderversorgt werden, Regenwälder und boreale Wälder unter mangelnder Bodenfeuchte leiden und Ackerland verödet. Für Nordrhein-Westfalen sind diese neuen Erkenntnisse aber noch nicht untersucht und nicht herunterskaliert worden.